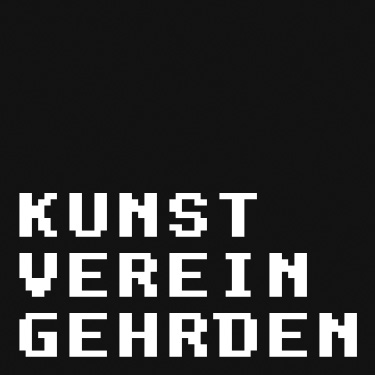Eröffnungsrede anlässlich der Ausstellung
POTENTIAL SPACE MODELS
von Benedikt Flückiger
im Kunstverein Gehrden.
9.11.2025 – 5.1.2026

Text: Lino Heissenberg
November 2025
Geschichten entstehen durch Unzufriedenheit, Unbequemlichkeit, durch ein „Nein“ gegenüber den Umständen. Jede Geschichte, so ließe sich annehmen, ist eine kleine Revolte, ein Aufbegehren: gegen das immer Gleiche, gegen den Alltag, gegen dessen einlullende Selbstzufriedenheit. Millionenfach strömen die Menschen in die Kinos, um zu sehen, wie die Welt zerstört wird, verschlingen Bücher, deren Hauptfiguren Alpträume durchleben, die wir unserem schlimmsten Feinden nicht wünschen, erleben Kunst, deren erklärtes Ziel es ist, ihnen, auf welche Art auch immer, wehzutun. Umgekehrt ließe sich annehmen, dass Utopien keine guten Geschichten anbieten. Wer will schon etwas hören über eine Welt, in der alles in Ordnung ist?
„Heute lief alles rund. Wir sind glücklich. Der Himmel ist blau.“
Ein schöner Zustand, ein denkbar schlechter Einstieg in eine Geschichte – man wartet auf den Twist, in dem sich alles zum Schlechteren wendet.
Natürlich ist die Welt der Fiktion längst nicht so einfach. Es gibt sie, die Utopien, die die Massen erreicht und berührt haben. In der westlichen Popkultur des 20. Jahrhunderts ist das bekannteste Beispiel sicherlich Star Trek: Nicht in einer post-apokalyptischen, sondern einer post-kapitalistischen Welt ist es der Menschheit gelungen, durch Zusammenarbeit und Fortschrittsglauben die Lichtbarriere zu durchbrechen und den Kosmos zu erforschen. Alle Crewmitglieder des Raumschiffs USS Enterprise sind freiwillig dort – Arbeit ist seit der Erfindung des Replikators nicht mehr notwendig. Alle eint der Glaube daran, dass Neugierde allein ausreicht, um jahrelang im Weltraum auf Reisen zu sein – klimaneutral und non-profit.
Aber wie kann man in so einer Welt Geschichten erzählen? Sehen wir über mehrere Staffeln die Crew schlicht auf der Brücke loungen, gelegentlich einen neuen Planeten kartographieren, und 3D-Schach spielen?
Star Trek gelingt es, eine Utopie vorzustellen, indem sie mit Nicht-Utopien kontrastiert wird. Immer wieder trifft die Crew auf neue Raumfahrer:innen, und diese sind häufig kriegswütig, hyperkapitalistisch, rassistisch, frauenfeindlich, umweltschädlich – alles, was die multinationale und multiplanetare Crew der USS Enterprise im Verständnis der 1960erjahre lange überwunden hat. Die Idee eines freundlichen Universums bleibt bestehen, eben weil gezeigt wird, dass es Arbeit war und ist, dies herzustellen und zu erhalten: die alten Muster sind immer nur das nächste Lichtjahr entfernt.
Der Titel „Potential Space Models“ ist für Wortspielfreunde eine wahre Freude. Wie deuten wir hier das Wort „Space“, wie „Models“, ist nur der „Space“ potentiell oder die gesamten „Space Models“? Gerade die älteren Modelle dieser Serie des Künstlers Benedikt Flückiger erinnern an die Set-Designs und Behind-The-Scenes-Aufnahmen der ersten Star-Trek-Staffeln. Sie haben einen holzigen Charme, verfügen über die ästhetischen Marker einer in der Vergangenheit imaginierten Zukunft, mechanisch, schwergängig, und eben: utopisch.
Die Potential Space Models, allesamt 36 Kubikzentimeter groß, sind zwar liebevoll arrangiert und gebaut, aber nicht von langer Hand geplant – das können sie gar nicht sein: Ihr Material sind die Überbleibsel früherer Ausstellungen, Überreste von Schrottplätzen, kurz: Müll.
Müll ist tatsächlich nicht einfach zu definieren. Obwohl die meisten von uns ihn klar visualisieren können, ist er in seiner Materialität nicht festgelegt. Müll sind sämtliche vom Menschen genutzte Materialien, für die dieser keine Verwendung mehr hat und derer er sich entledigen will. Im Tierreich und in der Natur ist Müll nicht bekannt. Müll entsteht nur in einer Welt, in der nicht in Kreisläufen, sondern mit einer Wegwerfmentalität gedacht wird: Müll ist dystopisch. Aber wie wir gelernt haben, haben Dystopien narratives Potential: Einer Utopie gegenübergestellt können sie diese strahlen lassen. Anders als die Crew der USS Enterprise nun betritt Flückiger nicht den von ihm erstellen Space mit dem erhobenen Zeigefinger, indem er ihm ein idealisiertes Gegenstück präsentiert, er arbeitet den Müll selbst um – errettet ihn aus seinem ihm ideologisch auferlegten Zustand, macht aus dem Material der Vergangenheit eine Vision eines möglichen zukünftigen
„Space“. Man kann das Recycling nennen – ein Begriff, der nur in einer Welt, die den Kreislauf eher als Ausnahme denn als Norm versteht, überhaupt Sinn ergibt – oder: utopisch.
Die ungeliebten Materialien dürfen ihr Potential in mehreren simulierten White Cubes entfalten. Der White Cube begleitet den Kunstbetrieb seit über einhundert Jahren. Nicht wenige Kunstschaffende haben ihn selbst zum Gegenstand ihrer Arbeiten gemacht, ihn persifliert, kritisiert, in Angriff genommen. Flückiger nun miniaturisiert ihn, macht ihn kontrollier- und händelbar, reproduziert ihn aber auch – mit Materialien, die dem White Cube eigentlich nicht mehr genügen. Der White Cube, lange das Standardmodell der Ausstellungsarchitektur, wirkt vermehrt selbst wie ein Relikt, eine Vision der Zukunft, die lange zurückliegt. Arrogant, steril und menschenfeindlich. Seine Miniaturisierung musealisiert ihn nahezu, stellt ihn aus wie ein Filmset, und doch wird ihm nicht erlaubt, das Hauptthema der Potential Space Models zu sein – zu voll ist er gebaut, und zu klein, um seine Überwältigungsstrategie auszuspielen. Anders als das Modell der USS Enterprise, das uns durch clevere Kameratricks riesenhaft erscheint, wird hier ein dominantes Ausstellungskonzept durch die Ausstellung seiner selbst geschwächt.
Was fasziniert uns eigentlich an Miniaturen, an Dioramen, Puppen, Polly Pocket, Schneekugeln, Zinnsoldaten, Modelleisenbahnen? Simon Garfield liefert in seinem Buch „In Miniature“ bereits im Untertitel eine einleuchtende Erklärung: „How Small Things Illuminate The World“. Die Miniatur erklärt die Welt wie Landkarten, erlaubt einen Überblick, gibt uns einen „God’s View“ auf die Dinge, gibt uns die Kontrolle zurück über eine unübersichtliche Welt. Aber ist das, wie wir die Potential Space Models erleben? Erklären sie uns die Welt? Oder werfen sie nicht eher neue Fragen auf? Für was sind diese Kuben denn nun Modelle? Ein Modell ist ja nur eine Vorform, ein Plan, oder ein Abbild eines Originals. Aber es gibt keine Originale für die Potential Space Models, sie selbst stehen nur in Abhängigkeit zueinander und zu unserer Mustererkennung – unserer Fähigkeit, sie sich groß, in der Welt der Skala 1:1, vorzustellen. Sicher gibt es Vorbilder, kunstgeschichtliche, filmische, fotografische, aber ein geschrumpfter Eiffelturm, eine Übersichtskarte über den Louvre, das sind sie eben nicht. Sie schlagen einen Raum vor, den sie selbst bereits umsetzen.
Vielleicht ist der spannendste Vergleich nicht zu finden in der Kunstwelt selbst, sondern in der Forensik. Frances Glessner Lee, eine US-amerikanische Vorreiterin der forensischen Wissenschaften, erschuf ab den 1930er-Jahren Dioramen schrecklicher Mordfälle. Niedliche Puppen, ermordet in 20 liebevoll gestalteten Interieurs, deren akkurate Zustände Glessner Lee durch den Besuch von Autopsien recherchierte. Bis heute sind die „Nutshell Studies of Unexplained Death“ im Einsatz, da ihre Liebe zum Detail zur Schulung der Beobachtungsgabe als wegweisend gilt. Wichtig dabei: Die Lösungen zu den gezeigten Mordfällen sind bis heute unter Verschluss. Die Nutshell Studies kommen ohne Erklärung, ohne Saaltext. Vor den Betrachtenden breitet sich eine Szene aus, die als Miniatur beherrschbar wirkt, aber doch undurchdringlich bleibt. Was ist hier geschehen? Kann man das überhaupt fragen? Denn – im Grunde ist ja nichts geschehen. Niemand wurde hier tatsächlich ermordet. Es sind keine Tatorte, es sind Inszenierungen potentieller Morde, sowie die Potential Space Models Inszenierungen potentieller Räume sind.
Doch so wie die Nutshell Studies Auflösungen haben, die sich nur durch Kenntnisse über die Welt außerhalb der Miniatur herleiten lassen, so erlauben die Potential Space Models Ideen über die reale, nicht modellhafte Welt, der sie gegenübergestellt werden: Es geht vielleicht ohne Verschwendung von Ressourcen, ohne Unterwerfung unter das Diktat, wie Kunst zu sein hat. „Is this the most interesting period of your main character’s life? If not, why aren’t you showing us that?“, fragt ein User in einem Forum für angehende Schriftsteller. Der Satz wird kontrovers diskutiert, zurecht: In Star Trek wird gerne auf die Vergangenheit Bezug genommen. Die Erde, die Menschheit, hat ihre interessanteste Phase längst hinter sich. Viele der Figuren der USS Enterprise, egal wie häufig sie Gefahren ausgesetzt sind, leben auf ihr im Vergleich zu ihren abenteuerlichen Vorgeschichten wie auf einer immerwährenden Kreuzfahrt. Und auch die Materialien, derer sich Flückiger bedient, haben ein Vorleben, das oberflächlich weit überstrahlt, was er ihnen noch entlocken kann. In Wirklichkeit ist jedoch das Gegenteil der Fall: Durch die schreckliche Vergangenheit der Erde strahlt die Utopie auf der USS Enterprise umso heller. Dadurch, dass Flückigers Potential Space Models ein Vorleben haben, erhalten sie überhaupt erst Modellcharakter, gestalten sie den Raum, entfalten sie ihr Potential.